Am 15. Oktober fand der 20. Freiburger Mittelstandskongress im Konzerthaus statt. Die Macher wollten in diesem Jahr vieles anders machen: weniger gewichtige Speaker, dafür mehr Zeit für Dialog und echten Austausch – auch auf der Bühne. Vieles ist gelungen, manches nicht.
Text: Julia Donáth-Kneer, Kathrin Ermert • Fotos: Felix Groteloh
Die erste Neuerung steht um Punkt neun Uhr morgens auf der Bühne des runden Saals im Freiburger Konzerthaus und begrüßt die gut 500 Gäste: Mary-Jane Bolten begleitet als Moderatorin durch den Kongresstag. Das ist ein Novum, damit will die veranstaltende Agentur Spielplan4 das Motto „Reality Check – Wo der Mittelstand der Wahrheit ins Auge blickt“ präsent halten. Bolten ist selbst Unternehmerin, sie führt gemeinsam mit Patrick Breitenbach, der am Nachmittag auch noch eine Rolle spielen wird, die Frankfurter Unternehmensberatung 1789 Consulting. Die hat sich auf Organisationsentwicklung spezialisiert und bezeichnet sich laut Website als „forschungsorientierte Beratung“. Das deutet schonmal die Flughöhe an, die zum Ende des Tages etwas abhebt, aber dazu später mehr. Zunächst plaudert Moderatorin Bolten mit der KI-Journalistin Marie Kilg von der Deutschen Welle über künstliche Intelligenz und den Umgang damit. Die Expertin, die Amazons Alexa mitdesignt hat, empfiehlt, KI da zu testen, wo man sich auskennt: „Tut so, als sei die KI euer Praktikant. Gebt ihr keine Aufgaben, die ihr selbst nicht versteht.“
Der Unterscheid zwischen menschlichem Denken und KI
Um KI geht es auch im Eröffnungsvortrag von Henning Beck. Der Neurowissenschaftler ist ein erfahrener Speaker. Er weiß, wie man Wissenschaft so präsentiert, dass sie jeder spannend findet, und hat dafür so manchen Preis abgeräumt, etwa den deutschen Meistertitel im Science Slam. Das merkt man: Die Leute hängen an seinen Lippen, es gibt viele Lacher, einige Aha-Momente und am Schluss tosenden Applaus. Becks Thema: Was passiert, wenn wir denken und wie unterscheiden wir uns dabei von der KI? „Lernen ist nichts Besonderes, alle Lebewesen lernen. Wir verstehen“, sagt der 41-Jährige. Das sei ein riesiger Unterschied, denn: „Man kann Dinge verlernen. Aber einmal verstanden kann man sie nicht entverstehen.“

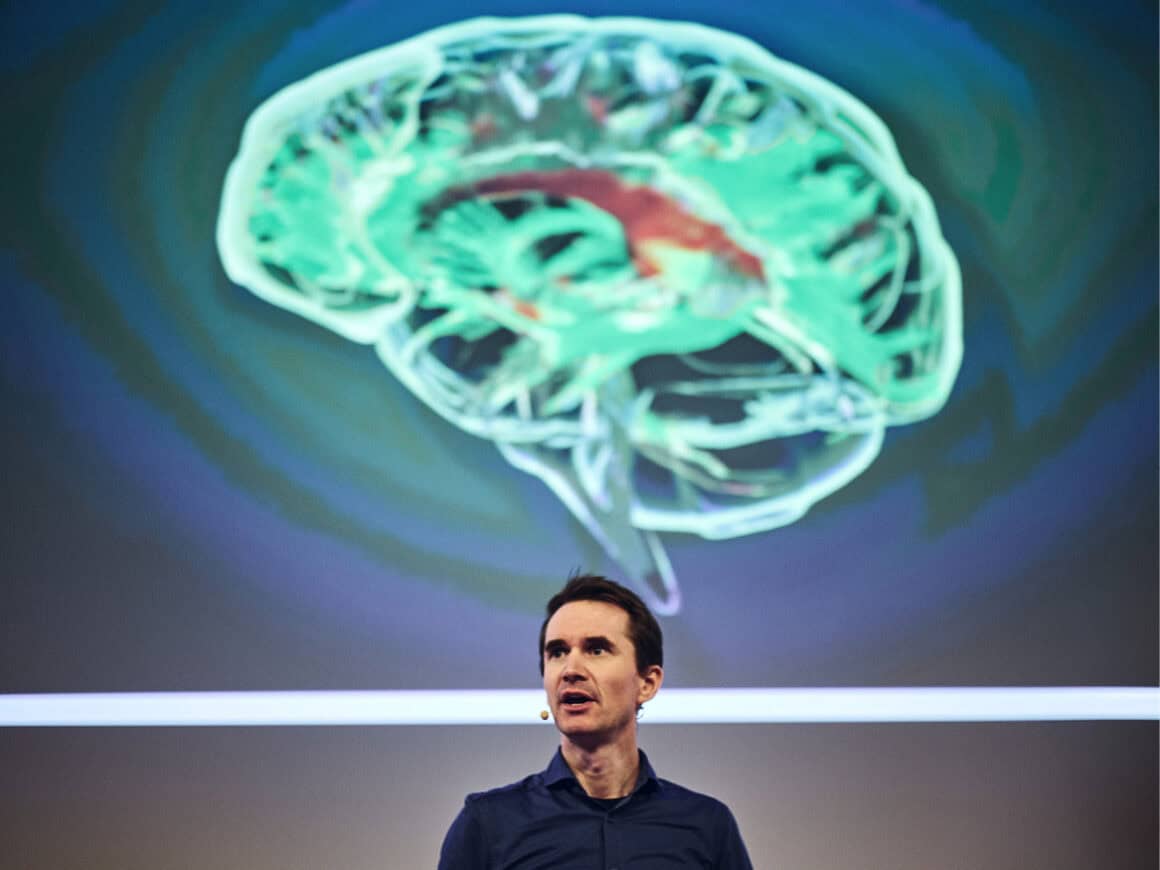
Diese Fähigkeit mache uns einzigartig. Etwas auszuprobieren, ohne zu wissen, was passiert, das sei unternehmerische Freiheit, meint Beck: „Testen, entscheiden, konzeptionell vom Ende her denken. Das macht die KI nicht.“ Nur indem man Bestehendes hinterfrage, entstehe echter Fortschritt, sagt der Biochemiker und schließt seinen Vortrag mit vier Prämissen. Erstens: Denkmuster durchbrechen. „Wer konzeptionell denken möchte, sollte nicht in die Vergangenheit schauen, um zu entscheiden, wie die Zukunft wird“, sagt er. Zweitens: Dinge vereinfachen. Der Mensch tendiere dazu, immer noch mehr hinzuzufügen, wenn er nach einer Lösung sucht, dabei sorge das Weglassen in vielen Fällen für klügere Ideen. Drittens: Perspektive wechseln. Nur wer in der Lage ist, Strategien anzupassen, leistet mehr als reinen Dienst nach Vorschrift. Und viertens: Neues wagen. „Clevere Fehler im Denken unterscheiden Mensch von Maschine“, sagt Henning Beck. Also: „Traut euch so zu denken wie keiner jemals zuvor.“
Tacheles zu Boomern und Bürokratie
Einige junge Leute trauen sich kurz drauf beim Treffpunkt Tacheles mit dem Titel „Hey Unternehmer-Boomer“ der älteren Führungsriege ihre Meinung zu sagen. „Seid offen für neue Technologien“ ist da zu hören. „Ihr wisst vieles gut – aber nicht immer besser. Hört uns zu und vertraut uns. Ihr könnt auch von uns lernen.“ Oder: „Investiert nicht in erfahrene, sondern auch in künftige Führungskräfte – und vor allem in langfristigere Bildungsformate.“ Die anwesenden Älteren reagieren verständnisvoll, manch eine Forderung kennen sie aus eigener Erfahrung. Schließlich sind Generationenkonflikte wahrscheinlich so alt wie die Menschheit, wie Gesprächsleiter Peter Behrendt mit einem 3000 Jahre alten Sumerer-Zitat belegt. Einig ist man sich, dass es Kommunikation braucht, damit sich die unterschiedlichen Altersgruppen verstehen. Ein Kongressteilnehmer der Generation Boomer zitiert einen alten Ratschlag: „Ein guter Geschäftsführer setzt sich beim Mittagessen an den Tisch der Azubis.“
Bei der zweiten Tacheles-Runde stellt sich Carsten Gabbert der Kritik über Bürokratie. Der Regierungspräsident sagt, dass in der Diskussion vieles in einen Topf geworfen werde und Regulierungen beispielsweise von Müllentsorgung und Bebauung ihre Berechtigung hätten. Aber er räumt auch ein, „dass es Bereiche gibt, wo es zu viel ist.“ Unternehmer Bernhard Schmolck moniert zu große Behörden, unklare Zuständigkeiten und eine „Diktatur der kleinen Verwaltungsbeamten“, die aus Angst vor der Verantwortung Prozesse verkomplizieren. Es gibt viele Zwischentöne und Verbesserungsvorschläge. Heike Hundertmark, Anteilseignerin eines Schmierstoffherstellers, schlägt vor, den Verwaltungsaufwand vor allem bei Dokumentationspflichten zu digitalisieren. Niklas Hirsch, der Erfahrung in der Verwaltung und als Unternehmer hat, findet es gut, „dass wir als Gesellschaft Dinge regulieren“. Aber die Prozesse seien schlecht, die will er optimieren. Am Ende sind sich Podium und Plenum weitgehend einig: Auf die Frage „Ist das Bürokratiemonster Mythos oder Wahrheit?“ gibt es keine einfache Antwort. Man muss das Thema, wie so oft, differenziert betrachten.


Zwei Ex-Banker zum Thema Finanzierung
Das gilt natürlich auch fürs Finanzielle. Zum Reality Check in Sachen Bankgespräch hat Spielplan4 zwei ehemalige Topbanker eingeladen: Marcel Thimm, bis Ende 2022 Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Freiburg, und Uwe Barth, der sich Ende 2024 als Vorstandssprecher der Volksbank Freiburg verabschiedete. Die Idee, dass die beiden offener reden, weil sie keine Verantwortung mehr tragen, geht auf. Thimm gesteht zum Beispiel, er habe nicht das Zutrauen, dass die Regulatorik wieder besser, sprich einfacher wird: „Wenn ein Apparat eine gewisse Größe hat, beschäftigt er sich selbst.“ Barth ergänzt, dass das Mehr an Regeln bei Regionalbanken nicht zu besseren Kreditentscheidungen geführt habe: „Das ist ein Riesenaufwand, den wir machen, die Hälfte würde für vernünftige Entscheidungen reichen.“
Einig sind sich die beiden auch bei den anderen Themen, über die sie mit Mary-Jane Bolten sprechen: Sie betonen, wie wichtig Vertrauen und Offenheit für Kreditentscheidungen sind und dass der Unterschied zwischen Groß- und Regionalbanken in ihrer lokalen Begrenzung liegt. Letztere hätten auch einen Großteil der Mitarbeitenden ihrer Firmenkunden als Kundschaft, mit deren Einlagen sie verantwortungsvoll und somit nicht riskant umgehen. Unterschiedlich bewerten die Ex-Vorstände allerdings die aktuelle Situation. „Man spürt, dass die goldenen Jahre vorbei sind“, sagt Barth, während Thimm betont: „Banken und Unternehmen geht es heute viel besser als vor 25 Jahren nach der geplatzten Dotcom-Blase.“
Über Organisationen, Individuen und brauchbare Illegalität
Der freche Titel von Judith Musters Vortrags – „Wie man dem Menschen gerecht wird, indem man den Großteil seines Wesens ignoriert“ – sorgt dafür, dass der kleinere der Konferenzräume bis auf den letzten Platz belegt ist, einige müssen stehen. Die 46-jährige Soziologin ist Wissenschaftlerin und Praktikerin. Als Partnerin der Unternehmensberatung Metaplan berät sie Unternehmen zu Reorganisationen, Strategieentwicklung und Projektführung. Außerdem forscht, lehrt und publiziert sie an der Universität Potsdam. Im Gespräch mit der Freiburger Organisationsberaterin Julia Henke geht es um die „Humanisierung der Organisation“. Musters These: Ein großes Problem von Organisationen ist es, dass sie den Menschen in den Fokus heben. Sie wälzten damit Probleme auf den Einzelnen ab, ohne ihm gleichzeitig das an die Hand zu geben, was er braucht, um sie zu lösen.
Die Soziologin, die gemeinsam mit zwei Kollegen ein Buch zum Thema geschrieben hat, erläutert ihre These an einem Beispiel: Es kommt häufig vor, dass jemand seine Arbeit nur erledigen kann, indem er immer wieder von den Vorschriften abweicht – zum Beispiel, wenn er auf kurzen Wegen die Schutzkleidung weglässt oder sich Informationen informell besorgt, statt Formulare auszufüllen. Diese Workarounds heißen in der Soziologie „brauchbare Illegalität“ und sind gängige Praxis. Das Problem: Wenn jeder so handelt, wie er denkt, greifen die Mechanismen und Strukturen der Organisation nicht – besonders kritisch in Transformationsprozessen. „Wenn sich Kundenbedürfnisse, Technologie und Marktbedingungen verändern, ist Innovation fast zwangsläufig nötig. Aber die stört natürlich die eingespielten Abläufe und löst fast immer Widerstand aus“, sagt Muster. Es sei Führung nötig, um notwendige Innovationen durchzusetzen.
Die Philosophie der Wirtschaft
Leadership ist natürlich auch bei Familienunternehmen ein Thema. „Führung bedeutet, gelingende Kooperationen zu schaffen. Auch mit kritischen Geistern. Die bringen Organisationen oft weiter, auch wenn es anstrengend ist.“ So klingt es, wenn ein Philosoph Unternehmer wird, wie es Frank Obergfell getan hat. Nach Studium und Promotion in Philosophie übernahm er in vierter Generation die Firma Kundo, die vergangenes Jahr ihr 125. Jubiläum gefeiert hat. 1899 in St. Georgen im Schwarzwald als Feinmechanikwerkstatt gegründet, hat das Unternehmen sich und sein Portfolio immer wieder neu erfunden: von der Funkuhr über Messtechnik für Heizkostenverteiler zu Gaswarnsystemen und energieautarken Außentemperatursensoren von Heizungsanlagen.

Diese Reise setzt Tilmann Obergfell nun in fünfter Generation fort. Wie sie die Nachfolge gestaltet haben und welche Rolle die Familie für das Unternehmen spielt, erzählen Vater und Sohn im Gespräch mit Philippe Merz. Es geht um Unternehmenskultur, Transformation und Führung, um Vertrauen, Emotionen und die Familiencharta. Man merkt, dass sich die drei nicht das erste Mal mit diesen Themen beschäftigen. Die Beiträge klingen sehr reflektiert, der Ton ist offen und persönlich – vielleicht auch, weil der Moderator den Senior gut kennt. Frank Obergfell und Philippe Merz haben zusammen die Thales-Akademie gegründet, die just Philosophie und Wirtschaft zusammenbringt.
Turnaround eines Traditionsunternehmens
Anderer Raum, anderes Unternehmen: Oliver Eckert spricht über die vergangenen zehn Jahre des Dumont-Verlags, der eigentlich schon am Boden lag, als er COO wurde. „Wir waren 2015 ein gescheiterter Tageszeitungsverlag“, sagt der 52-Jährige. Das hieß: „Radikal umparken: Alte Rezepte weg. Neue Antworten her.“ Das Rezept des 1620 (!) gegründeten Familienunternehmens: Nicht das alte Kerngeschäft digitalisieren, sondern mit Diversifikation wachsen. Dumont verkaufte bis auf die Kölner alle regionalen Tageszeitungsverlage, ursprünglich das identitätsstiftende Geschäftsfeld, und kaufte viele, vor allem digitale, Unternehmen zu.

Heute hat Dumont drei Geschäftsfelder: Regionalmedien, Marketing Technology sowie Businessinformation und beschäftigt rund 2000 Mitarbeitende in acht Ländern. „Wir verstehen uns als Flotte von Unternehmen, wir integrieren nicht“, erklärt Oliver Eckert, selbst Betriebswirt und Journalist. In der Holding arbeiten lediglich 15 Menschen. Der Vorstand beschäftigt sich mit Zukäufen und strategischer Ausrichtung, nicht mit den einzelnen Unternehmen. Die sind alle selbstorganisiert, es gibt weder eine zentrale IT noch eine zentrale HR. Mit dieser „radikalen Dezentralität“ verzichte man auf Synergien, sagt Eckert: „Natürlich lassen wir damit Geld liegen. Aber diesen Trade-Off gehen wir ein.“ Mit Erfolg: Der Umsatz von Dumont lag 2024 bei 451 Millionen Euro (plus vier Prozent gegenüber dem Vorjahr), das Ergebnis bei mehr als 80 Millionen Euro. Rund dreiviertel des Umsatzes erzielen digitale Geschäftsmodelle. Die Gruppe wächst seit fünf Jahren wieder, trotz sinkender Auflagenzahlen der Regionalmedien. Kein Grund, sich auszuruhen. „Wir wissen nicht, wie das Geschäft in fünf Jahren aussieht“, sagt Eckert.
Die neuen Formate: Noch Luft nach oben
Am Nachmittag sprechen beim Talk „Next Reality“ Michelle Rowbotham, Director HR von Endress + Hauser, und Michael Overdick, Vizepräsident Technology Management bei Sick, mit Moderatorin Mary-Jane Bolten über die Entwicklung von Ökosystemen und darüber, was es braucht, um eine neue Realität zu kreieren. Beide starten mit einem kurzen, im Falle von Michelle Rowbotham sehr persönlichen Impuls, danach diskutieren sie in der Dreierrunde über die Umsetzung in ihren jeweiligen Unternehmen. Im Anschluss ordnen die Soziologin Judith Muster, der Philosoph Phillipe Merz und KI-Journalistin Marie Kilg das Gehörte ein. Dieser Teil gibt dem Format immerhin die nötige Brise Kurzweiligkeit, die zuvor fehlte. Ein Testballon, der mit einem konkreteren Thema durchaus Potenzial hätte.


Das gilt weniger für das vermeintlich große Finale. Luhmann: Das ist das Stichwort für Florian Städtler. Als der Name des Soziologen und Gesellschaftskritikers in der als „interaktive Session“ geplanten Schlussrunde fällt, schreitet er ein. Denn das ist für den Veranstalter des Mittelstandskongresses und Chef der Agentur Spielplan4 das Zeichen, dass das Gespräch in zu theoretische Sphären abgehoben hat. Moderatorin Mary-Jane Bolton und Podcaster Patrick Breitenbach haben sich mit ihren Thesen und Theorien vergaloppiert. „Es war ein Versuch“, sagt Städtler. Dass der nicht gänzlich gescheitert ist, ist den vier Mutigen zu verdanken, die das Dialogangebot dieser sogenannten Fishbowl, die eigentlich den ganzen Saal einbeziehen wollte, nutzen und sich auf die Bühne trauen. Der erste und die letzte, ein Unternehmensberater und eine Trainerin, fachsimpeln mit. Nummer zwei und drei aber versuchen tapfer, das Gespräch zurück in die Praxis zu ziehen. Es gelingt ihnen nur bedingt, ein Teil des Publikums verlässt vorzeitig den Saal. Sie verpassen den Abschied samt Rückblick von Kongressgründer Günter Monjau und Ausblick auf die nächste Ausgabe am 14. Oktober 2026. „An die Substanz. Erfolgsmodelle im Stresstest“ lautet das Motto. Und der Vorverkauf beginnt direkt.


