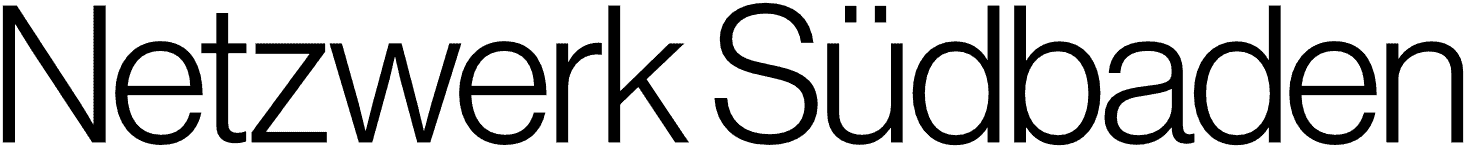Das Freiburger Stadttheater hat einen neuen Intendanten: Felix Rothenhäusler. Er folgt auf Peter Carp, der in den Ruhestand geht. Über die künstlerischen, programmatischen, strukturellen und personellen Veränderungen haben wir mit dem Intendanten, der kaufmännischen Direktorin Tessa Beecken und der Kommunikationschefin Shirin Saber gesprochen.
Interview: Christine Weis • Foto: Santiago Fanego
Herr Rothenhäusler, was wird sich am Theater Freiburg ab der nächsten Spielzeit wandeln?
Felix Rothenhäusler: Für den Chefdramaturgen Franz-Erdmann Meyer-Herder und mich war es zunächst wichtig, uns in den letzten eineinhalb Jahren ein genaues Bild zu machen und das Haus kennenzulernen, um zu sehen: Was gibt es? Was funktioniert gut? Dann haben wir viele Gespräche geführt, bei denen es darum ging, Mitarbeitende zu halten und Leute aus unserer künstlerischen Familie mitzubringen. Mit Blick auf die Kunst holen wir viele neue Menschen ins Haus – insbesondere neue Regiepositionen und Ensemblemitglieder. Viele andere Bereiche in diesem Mehrspartenhaus laufen sehr gut, an die knüpfen wir an.
Welche Bereiche sind das?
Rothenhäusler: Die Sparte Tanz mit der künstlerischen Leiterin Adriana Almeida Pees erweitern wir, indem wir Tanz ins gesamte Repertoire reinholen. Das ist eine Neuerung, die wir mit Adriana Almeida Pees gemeinsam entwickelt haben. In den Bereichen Konzert und Musiktheater hat sich Musikdirektor André de Ridder schon in den letzten drei Jahren mit der Frage beschäftigt, die auch uns wichtig ist: Wie verbinden wir uns mehr mit Themen und Menschen in der Stadt?
Was ist damit gemeint?
Rothenhäusler: Ich glaube, man muss bestimmte Fragen an bestimmten Orten stellen, damit sie einen Resonanzraum haben. Und ich bin überzeugt, dass man stärkere Wirkung durch die Zusammenarbeit mit bestehenden Institutionen erzeugt.
Können Sie dafür Beispiele nennen?
Rothenhäusler: Es gibt etwa eine Partnerschaft mit der Katholischen Akademie mit dem Titel Über Leben im Anthropozän. Dabei geht es um Klimawandel, Artensterben und Umweltzerstörung. Außerdem starten wir eine Kooperation mit dem Dokumentationszentrum Nationalsozialismus, bei der wir uns mit dem Ende der Zeitzeugenschaft und Erinnerungskultur auseinandersetzen. Ein weiteres Format heißt Bei Anruf Chor! Hier tritt der Kinder- und Jugendchor in sozialen und gemeinnützigen Einrichtungen auf. Er ist ein auch gutes Beispiel dafür, wie sich künstlerische Qualität und gesellschaftliche Öffnung verbinden lassen. Der Kinderchor steht sowohl in großen Opernproduktionen auf der Bühne als auch mit dem eigenen Projekt Keine wie meine Stadt. Dabei zeigen die Kinder, wie sie die Stadt erleben und wie sie sich die Zukunft vorstellen.

In dem neuen Programmheft propagieren Sie ein modernes Volkstheater. Was verstehen Sie darunter?
Rothenhäusler: Das meint vor allem eine große Bandbreite vom Musical über Klassiker wie Hamlet oder Der zerbrochene Krug bis hin zu themenbasierten Stückentwicklungen, die während des Probenprozesses entstehen. Wir wollen ein vielschichtiges Angebot machen und uns einerseits an ein Publikum wenden, das sich für Literatur interessiert. Andererseits werden wir mit neuen Formen überraschen, in denen sich Tanz, Musik und Schauspiel mischen. Theater soll ein sinnliches, intensives Erlebnis sein – und zugleich ein Raum, in dem Begegnung und Austausch möglich werden.
Das klingt nach einem offenen Haus.
Rothenhäusler: Absolut. Für mich ist wichtig, dass das Theater ein Ort mit Aufenthaltsqualität ist. Ein guter Gastgeber im besten Sinne. Hierfür haben wir eigene Formate entwickelt, wie unseren Karaoke-Abend, die Reihen Drinks & Drama, Pinsa & Jazz … Außerdem führen wir den Open Monday ein, bei dem wir einmal im Monat unser Foyer öffnen und die Freiburgerinnen und Freiburger zum ungezwungenen Verweilen mit Kunst und Kulinarik einladen.
Ist es nicht ein Spagat, die treue Stammkundschaft zu halten und gleichzeitig die weniger theateraffine Menschen anzusprechen?
Rothenhäusler: Ja, bestimmt, aber genau das ist unser Anspruch. Wir glauben an ein modernes Volkstheater, das keine Trennung zwischen Populärem und Intellektuellem macht.

sie die Leitung für Presse und Kommunikation am Theater Freiburg. Zuvor war sie am Schauspiel Frankfurt sowie bei der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit in Eschborn beschäftigt.
Frau Saber, mit dem neuen Konzept verändern sich auch Design und Kommunikation des Theaters. Das bunte Programmheft im Instastil mit Selfies der Mitarbeitenden, flammenden Herzen, Postern samt Tourshirt kommt knallig daher.
Shirin Saber: Ja, das war unser Ziel. Wir wollten zum Start der neuen Intendanz auch ein passendes neues Erscheinungsbild entwickeln. Hierfür haben wir einen strukturieren Prozess durchlaufen und eine Ausschreibung gemacht. Das Agenturkollektiv Hanna Osen und JMMP aus Hamburg hat den Pitch gewonnen. Ihr Konzept hat uns überzeugt, weil es unser künstlerisches Ideal gestalterisch auf den Punkt bringt.
Inwiefern?
Saber: Die Kampagne stellt die Menschen in den Mittelpunkt, die dieses Theater prägen: das Ensemble, die Mitarbeitenden hinter den Kulissen, in den Werkstätten, der Maske oder der Verwaltung. Die Ästhetik ist bewusst jung, frisch und humorvoll gehalten. Ab August geht die neue Website online, inklusive neuem Ticketsystem. Und zum Spielzeitstart Ende September wird es auch am Haus und in der Stadt eine sichtbare Signalwirkung geben. Mehr will ich noch nicht verraten. Man darf jedenfalls gespannt sein.
An neue Zielgruppen ranzukommen ist auch eine Aufgabe von Marketing und Öffentlichkeitsarbeit, wie gelingt das?
Saber: Wir versuchen, neben unseren klassischen Marketing-Maßnahmen vermehrt auch persönliche Berührungspunkte zu schaffen. Denn wir merken, wie viel es ausmacht, wenn wir mit Menschen direkt ins Gespräch kommen, zum Beispiel bei Infoständen oder bei der Summer Stage, unserem kostenlosen Open-Air-Theater auf dem Vorplatz. Im persönlichen Austausch kann man den Menschen etwaige Berührungsängste nehmen und Vorurteile abbauen, von wegen Theater ist nichts für mich. Gleichzeitig helfen auch niederschwellige Angebote im Spielplan, wie etwa die Karaoke-Reihe oder Talk-Formate. Wenn jemand denkt: Spannend, dass das Theater sowas anbietet, entsteht Neugier. Und wer den Besuch dann positiv erlebt, kommt bestenfalls wieder.

Von der Kommunikation zur Organisation. Frau Beecken, was verändert sich strukturell im Haus?
Tessa Beecken: An der grundsätzlichen Struktur der künstlerischen, technischen und organisatorischen Abteilungen ändert sich kaum etwas und auch weiterhin ist die abteilungsübergreifende Zusammenarbeit in den künstlerischen Projekten prägend für das Theater. Dazu kommen neue abteilungsübergreifende Gremien, eines für die spartenübergreifende Zusammenarbeit und ein weiteres für die Mitmach-Formate. Die Ausweitung der Kooperationen mit anderen Häusern und Institutionen wird auch in die Struktur hineinwirken.
Wie wirkt sich der Führungswechsel personell aus?
Beecken: Es ist in unserer Branche üblich, dass sich mit einer neuen Intendanz einiges verändert. Arbeitsrechtlich ist dies auch in den Tarifverträgen abgebildet, so im NV Bühne, der speziell für Künstlerinnen und Künstler gilt und auch bestimmte Leitungsfunktionen sowie die Öffentlichkeitsarbeit einschließt. Werden Verträge aus künstlerischen Gründen nicht verlängert, so sind im Tarifvertrag hierzu genaue Regelungen über die zeitlichen Vorläufe und Abfindungen formuliert. Aktuell hat das Theater 350 feste Stellen, dazu kommen 17 Auszubildende und Studierende im Bereich Oper in Kooperation mit der Freiburger Musikhochschule und ganz neu auch Schauspielstudierende, gemeinsam mit der Hochschule der Künste Bern.
Wie steht es um die wirtschaftliche Lage?
Beecken: Es gibt einen Wirtschaftsplan, an den wir uns halten. Als städtischer Eigenbetrieb haben wir schon die dritte Zielvereinbarung mit der Stadt, die jeweils über fünf Jahre läuft und dann neu verhandelt wird. Die Zielvereinbarung gibt uns einerseits finanzielle Planungssicherheit, formuliert andererseits künstlerische und strukturelle Ziele an den Theaterbetrieb. Ich war gerade erst bei der Bühnenvereinstagung, wo viel darüber diskutiert wurde, wie Städte und ihre Kultureinrichtungen enger und strategischer zusammenarbeiten können. Einige forderten dort genau solche langfristigen Vereinbarungen, wie sie in Freiburg schon seit über zehn Jahren bestehen.
Was genau ist in der Zielvereinbarung mit der Stadt festgelegt?
Beecken: Zum einen geht es um den grundsätzlichen Auftrag, Kunst zu produzieren, und zwar in einem vielfältigen Programm. Aber auch die finanziellen Rahmenbedingungen sind klar geregelt: also etwa die Höhe der Zuschüsse, die Pflicht die Ticketpreise regelmäßig anzupassen und Eigenmittel zu erwirtschaften. Dazu kommen weitere Punkte wie Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Gebäudesanierungen und konkrete Zielvorgaben für die Besucherzahlen.
Stehen aktuell Sanierungen an?
Beecken: Bei unserem komplexen Gebäude aus unterschiedlichen Bauepochen ist Sanierung eine Daueraufgabe. Wir wollen gar nicht erst in einen Generalsanierungsstau geraten, wie man ihn von anderen Häusern kennt. Konkret steht als Nächstes die Sanierung des Kleinen Hauses und von Teilen des Altbaus an. Die Vorplanungen laufen bereits, Baubeginn ist voraussichtlich 2027.
Und wo liegt die Messlatte bei den Besucherzahlen?
Beecken: Das Ziel sind 200.000 Besucher. In der Spielzeit 2023/24 lagen wir bei rund 193.000. Wir haben es gut geschafft, nach der Coronapause das Publikum wieder zurückzugewinnen. Das lag insbesondere daran, dass wir sehr schnell wieder gespielt haben und in dieser schwierigen Phase mit großer Flexibilität auf die Bedürfnisse des Publikums reagiert haben.
Wie finanziert sich das Theater?
Beecken: Wir bekommen rund 20 Millionen Euro Zuschuss von der Stadt und circa 10 Millionen vom Land. Unser wirtschaftlicher Eigenanteil liegt bei 13 Prozent, dieser speist sich aus Ticketerlösen, Drittmitteln, Spenden, Sponsoring und Einnahmen aus der Gastronomie. In der kommenden Saison erhöhen wir die Ticketpreise inflationsbedingt um etwa 10 Prozent. Wir haben die Garderoben-Erlöse im Gegenzug zur Erhöhung gestrichen. Außerdem wird es, wie vom Gemeinderat beschlossen, einen Kultur-Soli geben. Dieser Aufpreis von einem Euro beim regulären Ticket geht in einen Fördertopf für die freie Kulturszene.