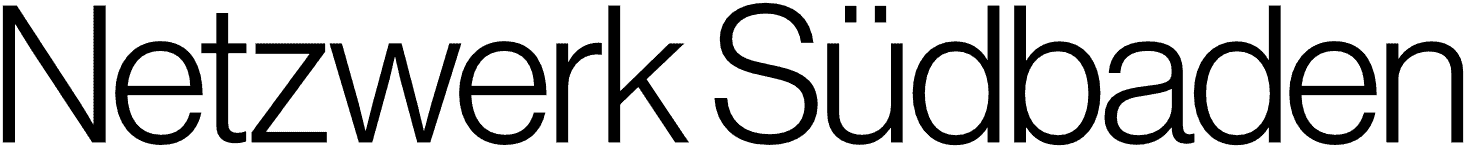Die Deutschen trinken weniger Wein und kaufen auch weniger Erzeugnisse aus dem eigenen Land. Wie Winzergenossenschaften und Weingüter in Südbaden dagegenhalten.
Text: Susanne Maerz
„Angespannte Situation auf dem Weinmarkt“ – mit diesen Worten überschreibt das Deutsche Weininstitut, die Kommunikations- und Marketingorganisation der deutschen Weinwirtschaft, die Lage 2023. Der Konsum ging in jenem Jahr um eine Flasche Wein pro Kopf auf 19,2 Liter zurück, der Absatz deutscher Weine um neun Prozent. Angesichts der Preissteigerungen sanken die Umsätze der Erzeuger nur um zwei Prozent. Hingegen verbuchten die Anbieter internationaler Weine zwei Prozent mehr Umsatz bei einem Absatzrückgang von einem Prozent.
Zahlen für das Jahr 2024 gibt es noch nicht, aber die Situation hat sich laut Stephan Danner, Vorstand der Genossenschaft Durbacher Winzer, Sprecher des Marketing- und Tourismusvereins Weinparadies Ortenau und Vizepräsident des Badischen Weinbauverbands, nicht geändert. Schließlich seien auch die Rahmenbedingungen dieselben geblieben. Fachkräfte- und Nachwuchsmangel, gestiegener Mindestlohn sowie Bürokratie nennt er als aktuelle Themen.
Auch aus Gründen wie diesen ist die Zahl der Betriebe zurückgegangen – deutschlandweit um etwa ein Viertel innerhalb von zehn Jahren. Besonders stark betroffen ist laut Deutschem Weinbauverband Baden. In der hiesigen Region sank danach die Zahl der Betriebe von 4500 im Jahr 2013 auf 3550 im Jahr 2023. Dazu kommt die Kampagne der Weltgesundheitsorganisation WHO, die unter dem Motto „redifine alcohol“ vor den Folgen des Alkoholkonsums warnt. Bücher wie „Warum ich keinen Alkohol mehr trinke“ des Bestsellerautors Bas Kast passen zu dem Trend. Gleichwohl meint Danner, man müsse abwarten, ob sich die Trinkgewohnheiten langfristig ändern. „Ich glaube, dass die Menschen wegen der Preissteigerungen zurzeit auch am Alkohol sparen“, sagt er.
Durbacher Winzer: Besser als der Markt
Also alles negativ? Natürlich nicht. „Unsere Betriebe sind gesund“, sagt Stephan Danner. 130 Betriebe bauen auf 330 Hektar Wein an und beliefern damit die Genossenschaft. Diese entwickelte sich laut ihrem Vorstand vergangenes Jahr immerhin besser als der Markt. Das bedeutet konkret: Die Umsätze stagnierten in etwa auf dem Niveau von 2023. Damit sei er nicht „ganz zufrieden“. Sorgenvoller blickt Danner ins laufende Jahr, so wie auch viele andere Betriebe. „Wegen Frost und Nässe war die Ernte in der Ortenau 2024 katastrophal“, berichtet Danner. „Ich bin froh, wenn wir alle Kunden bedienen können.“
Diese liegen zunehmend auch außerhalb Deutschlands. Die wichtigsten internationalen Märkte für deutsche Erzeuger, die USA und Norwegen, verzeichneten zuletzt zwar leichte Rückgänge, dagegen legten die anderen wichtigen Exportländer, die Niederlande, Schweden und Polen, zu. Dies geht aus dem Bericht des Deutsche Weininstituts hervor.

Auf diesen Märkten sind auch Weinbauer aus der Region aktiv, allen voran kleine und hochwertige Weingüter, wie Danner berichtet. Aber auch die Durbacher Winzer betreiben Export. Der Anteil am Umsatz liegt derzeit bei drei Prozent. Ziel sei, ihn auf zehn Prozent zu steigern. Einfach sei dies aber nicht. „Man braucht einen langen Atem, viel Geld, Enthusiasmus und Glück“, sagt der Genossenschaftsvorstand.
Neben dem Ausland setzen immer mehr Weinerzeuger auf alkoholfreie Produkte. In der Ortenau sind es etwa 80 Prozent der Betriebe, schätzt Stephan Danner. Darunter sind auch die Durbacher Winzer, die seit vier Jahren einen alkoholfreien Sekt im Portfolio haben. „Das läuft gut, es gibt einen kleinen, aber wachsenden Markt für alkoholfreien Sekt und Secco“, sagt Danner. Dieses Frühjahr bringen die Genossen zudem einen alkoholfreien Wein auf den Markt. Der Vorstand ist sich sicher, dass die Nachfrage danach steigen und bleiben wird. Auch für Cuvées, aromatisierte Weine oder Seccos beispielsweise mit Maracuja-Geschmack sieht er einen Markt, ebenfalls für Produkte mit weniger Alkohol.
Badischer Winzerkeller: Lizenzweine als erfolgreiche Strategie
Diesen Markt bedient der Badische Winzerkeller in Breisach seit vergangenem Jahr mit „Sonnja“, einem Weinmischgetränk auf Rosébasis mit nur sieben Prozent Alkohol. Die Einführung wurde von einer aufwendigen Marketingkampagne allen voran auf Social Media begleitet, mit eigenem Song und T-Shirts. Ziel war und ist es, damit die jüngere Generation zu erreichen, die zu 50 Prozent keinen Alkohol und zu 75 Prozent keinen Wein trinkt. „Es ist sehr gut angelaufen“, sagt der Vorstandsvorsitzende André Weltz. Dieses Jahr will der Badische Winzerkeller das Produkt weiter pushen – zum Beispiel mit einer Kampagne auf dem Festival „Pinot and Rock“ in Breisach.
Weitere Mischgetränke sind laut Weltz derzeit nicht geplant. „Wir denken lediglich über eine maßvolle Ausweitung nach“, sagt er. Schließlich reduziert die Genossenschaft im Rahmen der Neuaufstellung seit mehreren Jahren das Sortiment. Dies sowie der Umbau des gesamten Unternehmens war angesichts roter Zahlen nötig und macht sich bezahlt: „2024 lief bei uns anders als in der Branche insgesamt“, sagt Weltz. Der Umsatz sei um etwa vier Prozent, der Absatz um zehn Prozent gewachsen.
Das neue Weinmischgetränk hat daran indes nur einen minimalen Anteil. Auch der Umsatz mit alkoholfreiem Sekt, den es seit Jahren gibt, ist laut Weltz „eher gering“. Trotzdem hat der Badische Winzerkeller vergangenen Sommer seinen ersten alkoholfreien Wein auf den Markt gebracht. Denn, so erklärt er, vor allem der Dry January „schlägt inzwischen wirklich auf den Umsatz durch“. Kunden des Unternehmens sind in erster Linie der Lebensmitteleinzelhandel sowie Discounter. Auch wenn der Markt für alkoholfreien Wein noch sehr gering sei, entwickelte er sich „sehr dynamisch“. Beim alkoholfreien Bier habe es schließlich auch eine Weile gedauert, bis der Durchbruch gelungen sei.

Bereits erfolgreich läuft das Lizenzgeschäft, mit dem der Badische Winzerkeller inzwischen neun Prozent des Umsatzes erwirtschaftet. Los ging es im Jahr 2016 mit den „Fischweinen“ für Gosch Sylt. Vergangenes Jahr sind Weine für den SC Freiburg dazugekommen und das Weinmischgetränk der Marke Almdudler. Ab diesem Jahr vermarkten die Breisacher zudem die Weinedition des ehemaligen Formel-1-Fahrers Ralf Schumacher.
Der Ausfuhranteil beim Badischen Winzerkeller ist gering. Laut Weltz liegt er im sechsstelligen Bereich. In vier Länder wird derzeit exportiert. Es könnten mehr werden. „Wir tragen uns mit dem Gedanken, den Export auszuweiten“, sagt Weltz. Erste Tests mit Asien laufen. Noch sei aber nichts spruchreif. Das Unternehmen beschäftigt 133 Mitarbeitende. Sie verarbeiten die Trauben, die 4000 Winzerinnen und Winzer auf insgesamt 1300 Hektar anbauen, und vermarkten den Wein.
Weingut Dr. Heger: Mehr Export und Finetuning
Wie ist die Lage bei den Weingütern? Sie setzen traditionell in erster Linie auf qualitativ hochwertige Produkte, mit denen sie eher in der Gastronomie als im Einzelhandel vertreten sind.
Das ist auch beim Weingut Dr. Heger aus Ihringen mit einer Rebfläche von 35 Hektar der Fall. Die Produkte aus eigenem Anbau heißen wie das Weingut, die von den Reben der Erzeugergemeinschaft tragen die Marke Weinhaus Heger, insgesamt sind 25 Mitarbeitende im Betrieb beschäftigt. Etwa 70 Prozent des Umsatzes erwirtschaftet das Familienunternehmen mit dem Fachhandel und der Gastronomie, circa 20 Prozent mit Privatkunden und etwa zehn Prozent mit dem Export.
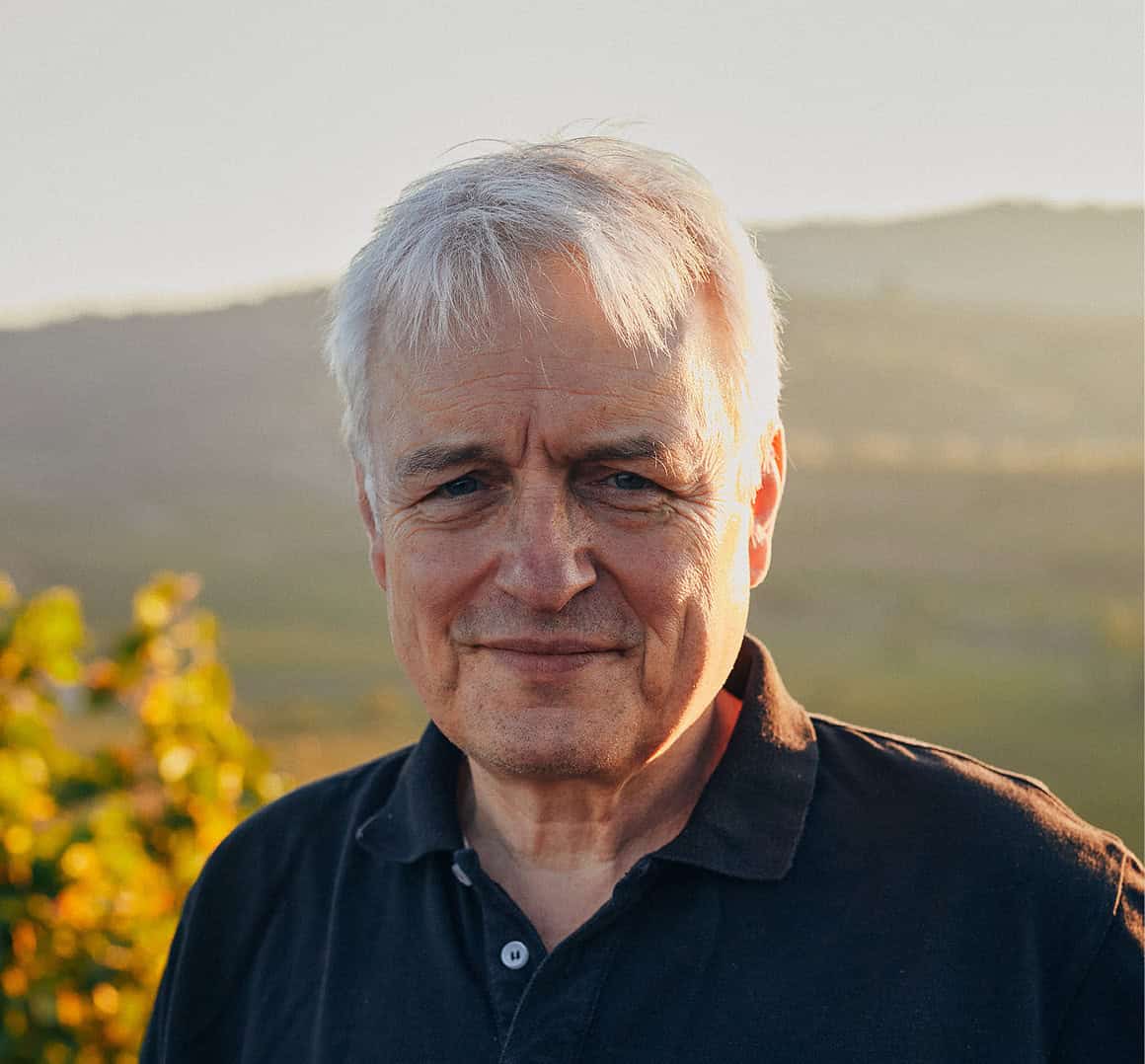

Stärkster Auslandsmarkt des Weingutes sind die Niederlande. „Da haben wir einen sehr guten Händler“, sagt Katharina Heger, die für Marketing und Export zuständig ist. Es folgen die Schweiz und die skandinavischen Länder, aber auch in England, den USA und in Asien haben die Ihringer feste Kunden. „Vor allem im gehobenen Bereich steigt die Nachfrage“, sagt sie. „Das ist ein schöner Trend, und es freut uns, wenn wir ihn bedienen dürfen.“ Ziel sei es, den Export mittelfristig auf 20 Prozent zu steigern.
Etwas weniger rosig ist derzeit die Lage in der Gastronomie. Konsumzurückhaltung, Personalmangel und Betriebsaufgaben machen der Branche zu schaffen. „Die Konsumzurückhaltung ist allgegenwärtig“, sagt auch Inhaber Joachim Heger, Katharina Hegers Vater. Das Weingut, das auf Burgundersorten spezialisiert ist, verzeichnete im vergangenen Jahr daher auch einen, wenn auch moderaten, Absatzrückgang. Heger führt dies zudem auf den verregneten Sommer zurück, der die Menschen weniger als sonst in die Außengastronomie zog.
Er ist überzeugt, dass der zurückgehende Weinkonsum „eine temporäre Erscheinung“ ist und berichtet von einem Trend hin zu besonderen Produkten, die auch teurer sein dürften. „Das kommt unserer Qualitäts- und Premiumstrategie entgegen, wir betreiben noch mehr Finetuning als früher“, sagt der Winzer. Allerdings würden die Kunden nicht mehr nur bei ihrem Stammweingut einkaufen.
Eine mögliche Strategie zur Kundenbindung sind für die Familie Heger daher Weinerlebnisse. Katharina Heger berichtet von einer steigenden Nachfrage danach. Auf alkoholfreie Produkte setzt das Weingut dagegen derzeit nicht. Der Prozess der qualitativen Entwicklung sei noch nicht abgeschlossen, sagt Katharina. „Dies überlassen wir den etablierten Spezialisten mit dem entsprechenden Know-how.“
Weingut Blankenhorn: Handwerk und angepasste Menge
Auch Martin Männer, Inhaber und Geschäftsführer des Weinguts Blankenhorn in Schliengen, bietet keine alkoholfreien Produkte an. „Ich möchte handwerkliche Manufakturprodukte und keine Industrieprodukte herstellen“, sagt er. Dazu werde alkoholfreier Wein aber angesichts des maschinellen Entalkoholisierungsprozesses. „Da sehe ich keinen Markt bei meinen Kunden“. Auch er selbst trinke, wenn er auf Alkohol verzichte, lieber Wasser oder Tee.
Auf den rückläufigen Weinmarkt reagiert Martin Männer, der das Weingut 2014 von der Familie Blankenhorn übernommen hat, mit Mengenreduktion: „Wir produzieren keine Höchstmengen mehr, sondern nur noch, was am Markt auch abgenommen wird“, erklärt er. Seine Zielgruppe seien „emanzipierte Weintrinker“, die lieber weniger trinken, aber dafür 20 Euro für eine Flasche Wein ausgeben. Martin Männer ärgert sich darüber, dass derzeit in der Öffentlichkeit ein Bild verbreitet werde, dass schon der erste Schluck Wein schade. Überhaupt gehe die Zahl die Weintrinker zurück – weil die jungen Menschen weniger Alkohol trinken.

Potenzial sieht Martin Männer dagegen im Export. Inzwischen macht er knapp 20 Prozent seines Umsatzes damit, allen voran mit den Benelux-Ländern, Dänemark und der Schweiz. „Es läuft gut, hat aber eine Weile gedauert, die Beziehungen zu den Importeuren aufzubauen“, sagt Männer. Gerade arbeitet er zudem am Markteintritt in England. 40 Prozent seines Umsatzes macht er mit Endkunden, 20 Prozent mit der Gastronomie, den Rest mit dem Fachhandel sowie ausgewählten inhabergeführten Lebensmitteleinzelhändlern.
Wie war das Jahr 2024 für das Weingut Blankenhorn? „Es lief wie das unbeständige Wetter – zwischen Vollgas und Vollbremsung“, sagt Männer. „Der Absatz könnte mehr sein, aber ich bin nicht unzufrieden.“ Der Herbst sei gut gewesen – „zum Glück hatten wir keinen Frost und keinen Hagel“. Mit seinem elfköpfigen Team baut er auf 25 Hektar vor allem Gutedel, Chardonnay und Spätburgunder an. Zurzeit läuft die Umstellung auf Bio. Auch da bleibt es für Männer spannend, ob seine Kunden mitgehen. Angenommen, so berichtet er, werden Veranstaltungen wie die Genusserlebnisse, die er seit dem Umbau des Weinguts vor zwei Jahren anbietet. Seine Beobachtung: „Die Kunden sind emanzipierter geworden und probieren gerne Neues aus.“