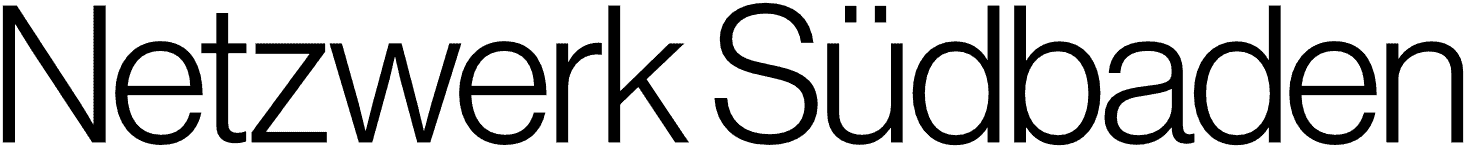Die Diagnose ist bekannt: Jahrelang wurden die Weichen falsch gestellt, wurde viel zu wenig in das Schienennetz und den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs investiert. Jetzt braucht es Tempo auf allen Strecken, um die Mobilitätswende zu bewältigen.
Text: Kathrin Ermert
Als Bertha Benz 1888 mit dem ersten Mercedes von Mannheim nach Pforzheim fuhr, gab es noch keine Tankstellen. Das Waschbenzin, das das motorisierte Dreirad brauchte, kaufte sie in Apotheken. Es vergingen einige Jahrzehnte, bis in den Zwanziger- und Dreißigerjahren des vergangenen Jahrhunderts Tankstellen und Autobahnen entstanden. Kurioserweise galten die neuen Automobile Anfang des 20. Jahrhunderts als saubere Alternative zu Kutschen und Fuhrwerken in großen Städten, weil die Pferde tonnenweise Mist produzierten.
Heute wissen wir: Das stimmt nicht. Diesel- und Benzinmotoren haben die Atmosphäre jahrzehntelang derart verschmutzt, dass die Natur leidet und die Erde sich erwärmt. Deshalb stehen wir jetzt wieder an einem ähnlichen Punkt wie vor hundert Jahren. Und man wünscht sich zurück, um die Hebel anders zu legen. Denn bevor das Auto die Vormacht übernahm, teilten sich Pferde, Kutschen, Fahrräder und die ersten Autos, damals vor allem Taxis, die Straße. Anfang des 20. Jahrhunderts konkurrierten verschiedene Technologien, es gab auch schon Elektroautos, doch der Verbrenner setzte sich durch. Das wichtigste Fortbewegungsmittel für längere Strecken war noch lange die Eisenbahn – wobei man generell weit weniger reiste.
Ab den 1970er-Jahren stieg die Zahl der Pkw rasant, und der Städtebau schuf die autogerechte Stadt.
Die Verkehrsprobleme der modernen westlichen Welt haben auch mit gewachsenem Wohlstand zu tun. Früher konnte sich kaum jemand ein eigenes Gefährt oder eine Reise leisten. Das änderte erst der wirtschaftliche Aufschwung nach dem Zweiten Weltkrieg. Noch 1960 kamen auf 1000 Menschen in der BRD gerade einmal 80 Autos. Ab den 1970er-Jahren stieg die Zahl rasant, und der Städtebau schuf die autogerechte Stadt. Mittlerweile haben statistisch gesehen 583 von 1000 Deutschen einen Pkw, im Autoland Baden-Württemberg sind es sogar 612. Parallel wurde die Eisenbahn vernachlässigt. Mit Ausnahme einiger Projekte nach der Wiedervereinigung investierte Deutschland kaum noch in die Schiene. Flugzeuge wurden zum Massenverkehrsmittel. Fliegen ist billig, auch weil Kerosin immer noch steuerbefreit ist.
Unsere gestiegenen Ansprüche an Mobilität nun mit dem Klimaschutz in Einklang zu bringen, ist eine große Herausforderung. Das sieht man gerade an der grün-schwarzen Landesregierung, die es nicht schafft, sich auf ein Mobilitätsgesetz zu einigen. Es gibt so viel zu tun, zu bauen, zu sanieren am besten alles gleichzeitig trotz leerer Kassen sowie fehlender Fachkräfte – und bitte, ohne der Autoindustrie zu schaden: besserer ÖPNV, zusätzliche Radwege, neue Ladesäulen. Ganz zu schweigen von der maroden Bahn. Je größer das Infrastrukturprojekt, desto langsamer kommt es voran, siehe Ausbau der Rheintalbahn. 1996 hatte sich die Bundesrepublik in einem Staatsvertrag mit der Schweiz verpflichtet, einen „leistungsfähigen Zulauf“ zur neuen Alpentransversale zu gewährleisten. Lötschberg – und Gotthardbasistunnel sind seit 2007 und 2016 fertig, weite Teile der Rheintalstrecke dagegen noch nicht einmal geplant.
Klar ist auch: Es braucht unterschiedliche Konzepte in Stadt und Land. Wo Busse oder Bahnen fahren und sich der Verkehr selbst lahmlegt, steigt die Bereitschaft, auf ein eigenes Auto zu verzichten. Deshalb liegen im Mobilitätsindex des ADAC die Stadtstaaten Berlin, Hamburg und Bremen nicht nur bei der Staulänge vorn, sondern auch bei der Carsharing-Dichte. Das sieht im ländlichen Baden-Württemberg ganz anders aus. Apropos ADAC: Der verändert sich mit der Mobilität. Er sieht sich nicht mehr nur als Automobilclub, sondern als Mobilitätsdienstleister für alle. In den zurückliegenden zwei, drei Jahren sind früher undenkbare Dinge geschehen. Das Ende vom Ablehnen des Tempolimits zum Beispiel. Der Beginn der Pannenhilfe für Fahrräder. Oder Aussagen des Präsidenten, das Auto auch mal stehen zu lassen und zu laufen. Wie seinerzeit Bertha Benz zur Apotheke.